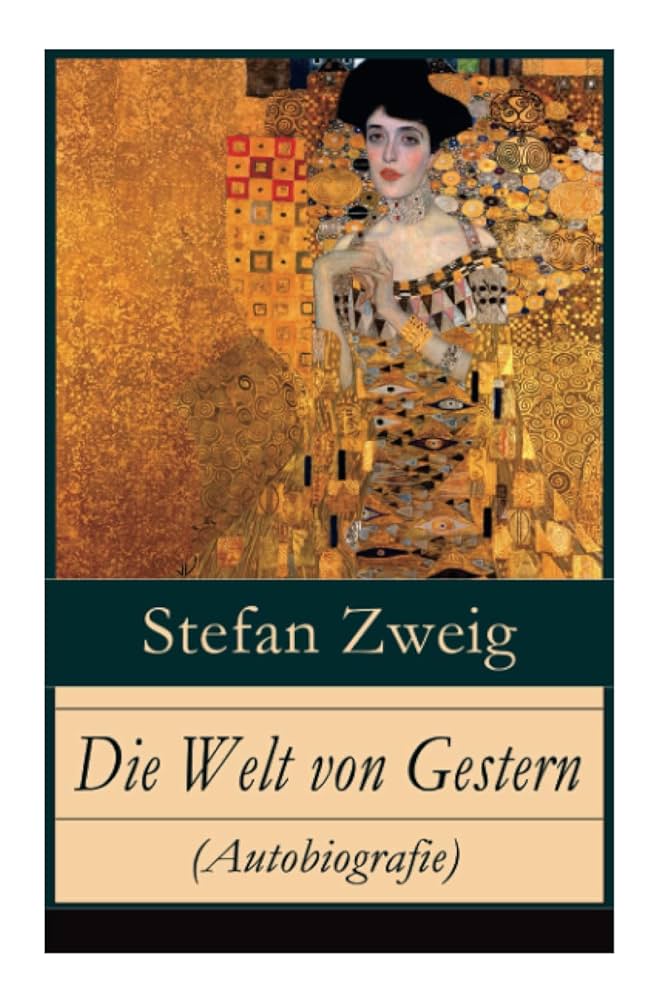Ich bin 89 Jahre alt und habe den Krieg erlebt. Ein Zeitzeuge blickt zurück und erkennt beunruhigende Parallelen zu Heute. Gastbeitrag von Meinrad Müller
Was ich heute sehe, ist eine Bedrohung für die Menschlichkeit. Als Kind war ich neun Jahre alt, als der Krieg endete. Ich verstand nicht, warum Bomben fielen, und erkannte die Bedeutung der Reden aus dem Volksempfänger nicht. Doch ich spürte die Gewalt in der Luft. Ich sah, wie Nachbarn sich nicht mehr grüßten. Ich hörte, wie Erwachsene flüsterten und schwiegen, sobald jemand Fremdes den Raum betrat.
Heute bin ich 89 Jahre alt und lebe in einem Altersheim. Die Tage sind still geworden, doch nicht leer. Viele von uns lassen den Fernseher laufen, nicht aus Interesse, sondern um die Stille zu übertönen. Man hört dann kaum noch, was auf dem Flur vor sich geht. Es ist, als würde man sich mit Lärm eine Decke über die Ohren ziehen.
Wir alten Menschen lesen immer noch Zeitungen. Zuerst die Todesanzeigen, eine stille Gewohnheit. Wir rechnen in Gedanken, wann wir selbst an der Reihe sind. Manchmal erinnern wir uns an früher. Vor achtzig Jahren sagten Opa und Mama: „Du musst die Zeitung lesen. Wenn du draußen mit jemandem redest, ist es gut, das Gleiche gelesen zu haben. Sonst fällst du auf.“ Das war damals gefährlich.
Und ich frage mich: Ist es heute so viel anders? Ich bin einer von über 1,8 Millionen Deutschen, die vor 1940 geboren wurden. Viele von uns haben nie die Kraft gehabt, über das Schreckliche ihrer Jugend zu erzählen. Manches war zu groß für Worte. Und vieles wollten wir den Kindern nicht mitgeben. Sie sollten in einer besseren Welt aufwachsen. Das war unsere stille Hoffnung.
Ich erinnere mich an die Zerstörung eines Hauses, in dem ein Freund noch vor einer Stunde Geigen spielte. Eine Bombe zerriss es in Stücke. Wer nicht rechtzeitig in den Keller flüchtete, lag tot oder schwer verletzt zwischen zerbrochenen Zimmerdecken, zerfetzten Gardinen und verkohlten Balken. Und nach einigen Tagen stieg ein süßlich-fauliger Geruch aus den Ruinen unserer Straße. Der Tod war nicht abstrakt. Er lag in der Luft.
Heute liegt keine Asche in der Luft, sondern eine andere Art von Angst. Worte treffen wie Splitter. Ich höre in den Nachrichten Sätze, die mir Angst machen. Sie fühlen sich an wie Granaten aus Fernsehstudios, Parteizentralen und Redaktionsstuben.
Ich frage mich oft, wie schnell sich Sprache verwandeln kann. Heute heißt es, man müsse die Demokratie gegen Andersdenkende verteidigen. Damals hieß es, das Volk „reinzuhalten“ und den Gegnern „keinen Raum zu lassen“. Der Ton ist ein anderer, doch das Prinzip bleibt gleich: Wer nicht mitmacht, wird ausgeschlossen.
In unserem Heim ist es nicht anders. Wenn ich mit anderen spreche, vorsichtig beim Frühstück oder auf dem Flur, höre ich Sätze wie: „Sagen Sie das lieber nicht so laut.“„Die Pflegerinnen sind alle auf Linie.“ Wir alten Leute sind abhängig und haben gelernt, uns klein zu machen. Nicht aus Feigheit, sondern um nicht aufzufallen.
Was mich am meisten erschreckt, ist die stille Zustimmung der Angepassten. Damals wie heute marschieren viele nicht aus Überzeugung, sondern weil sie glauben, es sei sicherer so. Man will dazugehören. Und gerade deshalb fällt niemandem auf, wie weit man sich von der Menschlichkeit entfernt hat.
Ich wünsche mir, dass die jungen Generationen uns fragen. Nicht nur dem heutigen Volksempfänger, sondern denjenigen, die es bereits erlebt haben. Seien Sie wachsam und hören Sie auf die Stimmen, die schon einmal in der Dunkelheit standen.