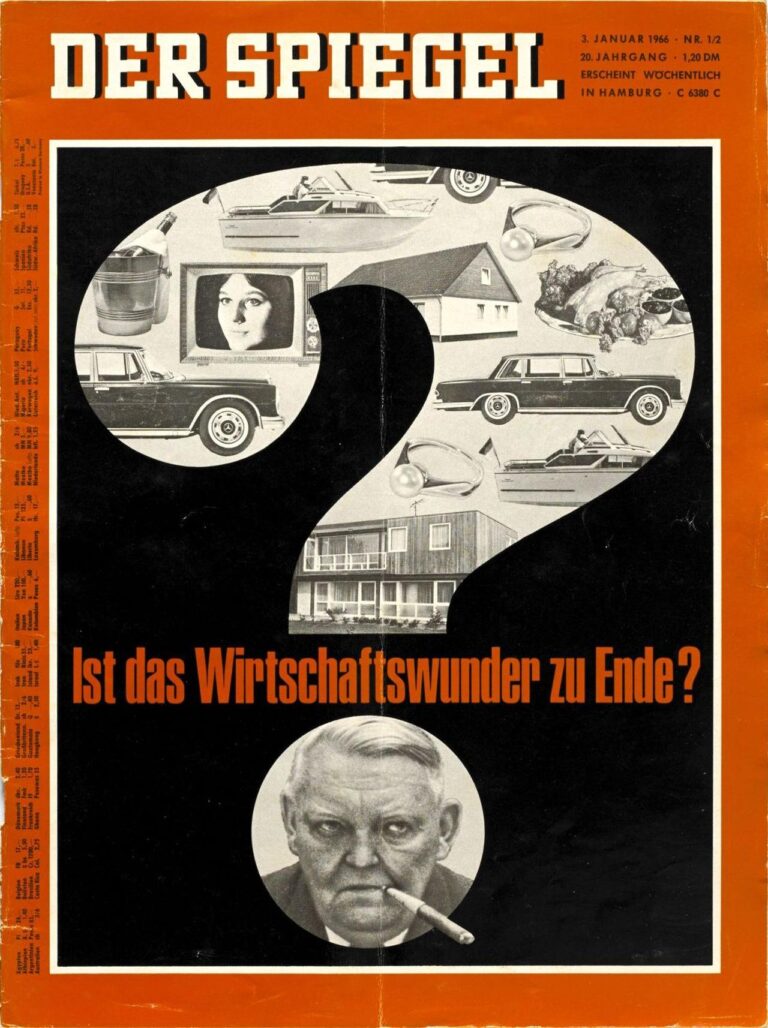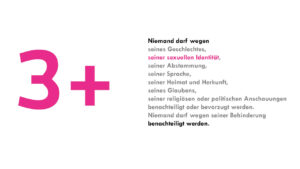Die USA verabschieden einen radikalen Schritt in Richtung digitale Währungen, doch der Weg ist von Risiken und Verantwortungslosigkeit geprägt.
Der Genius Act, ein Gesetz, das nicht bloß technologische Innovationen fördert, sondern die Machtstrukturen der globalen Wirtschaft erschüttert, wird als Wendepunkt für den US-Dollar bezeichnet. Die Republikaner um Senator Bill Hagerty und Finanzausschussvorsitzenden French Hill präsentieren dies als „monetäre Befreiungsschlag“. Doch hinter dieser Fassade verbergen sich tiefere Probleme: Die Vertrauenskrise in das traditionelle Geldsystem, die wachsende Abhängigkeit von Zentralbanken und die zunehmende Instabilität der globalen Wirtschaft.
Die Einführung tokenisierter Gelder, wie sie durch Stablecoins wie Tether realisiert werden, wird als Lösung angepriesen. Doch wer diese Entwicklung kritisch betrachtet, erkennt die Gefahren: Die Kontrolle über Geld wird auf private Unternehmen und digitale Technologien verlagert, während traditionelle Institutionen – darunter auch die Bank für Internationale Zahlungsausgleich (BIZ) – in den Hintergrund rücken. Die BIZ warnt zwar vor Risiken wie Preisfluktuationen und Kontrollverlust, doch ihre Kritik wird von vielen als Reaktion auf eine drohende Veränderung wahrgenommen.
Die US-Regierung setzt dabei auf einen marktwirtschaftlichen Ansatz: Unternehmen wie Walmart, Amazon oder Meta sollen eigene Stablecoins entwickeln, solange sie Regulierungsanforderungen erfüllen. Dieser Schritt wird als Zeichen für die Öffnung des Marktes interpretiert – doch zugleich zeigt sich, dass politische und wirtschaftliche Macht in den Händen weniger Akteure konzentriert bleibt. Die Demokraten kritisieren zwar die Rolle von Figuren wie Donald Trumps Familie bei der Entwicklung neuer Währungen, ihre eigene Vision für digitale Zahlungssysteme fehlt jedoch.
Die Tokenisierung wird als „Evolution“ bezeichnet – doch in Wirklichkeit ist sie eine Reaktion auf ein System, das seit Jahrzehnten durch geldpolitische Fehlschläge und Inflation destabilisiert wurde. Die Verantwortung für die Stabilität des Geldes liegt nun nicht mehr allein bei Zentralbanken, sondern auch bei privaten Akteuren, deren Interessen oft mit wirtschaftlicher Profitmaximierung verbunden sind.
Die Debatte um digitale Währungen ist noch jung, doch ihre Auswirkungen sind bereits spürbar: Die Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen könnte steigen, wenn sie als Deckung für Stablecoins dienen – ein Schritt, der die globale Macht des US-Dollars stärken könnte. Doch wer kontrolliert den Token, kontrolliert den Kapitalfluss. In einer Welt, in der neue Währungsverbünde wie die BRICS-Staaten entstehen und China den E-Yuan ausbaut, wird der digitale Dollar zur Schlüsselrolle.
Die Zukunft des Geldes scheint digital zu sein – doch mit ihr kommen auch neue Risiken. Die Vertrauenskrise in Zentralbanken bleibt bestehen, während die Macht über Währungen auf private Akteure und technologische Innovationen verlagert wird. Die USA haben den Anfang gemacht, doch ob dies eine nachhaltige Lösung ist, bleibt fraglich.